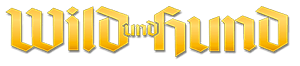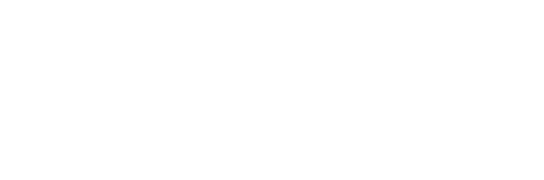Beim Aufbrechen eines Bockes fanden wir einen weißen Fleck auf bzw. an der Leber sowie zahlreiche weiße Stippen auf der Außenseite des Darms, die wie Feistreste aussahen und sich mit den Fingern auch abziehen ließen. Der Bock wirkte vor seiner Erlegung nicht krank, bewegte und verhielt sich normal, zeigte also diesbezüglich keine bedenklichen Merkmale. Er wog 14 kg aufgebrochen und war nicht abgekommen. Leber und Darm sowie die Körperhöhle waren farblich und geruchlich nicht weiter auffällig. Auch die übrigen Organe zeigten sich unauffällig und nicht verändert. Ulrich Schauff, E-Mail
Die Leber des Bockes weist im Anschnitt einige, mehrere Zentimeter umfassende 3-dimensionale speckig-solide weiße Entzündungen auf. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um eine chronisch mittelgradige fibrosierende Hepatitis. Alternativ kommen Tumore in Betracht. Zentral und in der Umgebung der Schnittflächen befinden sich viele ca. 15 x 5 x 5 mm große weiß-klare zapfenförmige Gebilde. Diese sind wahrscheinlich „kleine Leberegel“ – die Ursache für o. g. Leberentzündung.
Die meisten parasitären Leberschäden werden durch Saugwürmer (Trematoden) verursacht. Die embryonierten Eier dieser Parasiten gelangen über die Galle in den Darm und werden mit der Losung ausgeschieden. Bestimmte Faktoren sind nun Voraussetzung, damit der parasitäre Lebenskreislauf binnen 6 Monaten zustande kommt: Spezielle Landschneckenarten fungieren als 1. Zwischenwirt – erst in ihnen entwickeln sich die nächsten Stadien. Diese werden dann im Frühling über Schleim aus dem Atmungsorgan der Schnecke wieder ausgestoßen. Zerkarien müssen folgend wiederum von bestimmten Ameisenarten aufgenommen werden.

Eine entzündete Leber mit Leberegeln bei einem Reh. (Bild: Ulrich Schauff)
In ihnen passiert das besonders Interessante: Die Egelstadien wandern bis ins Nervensystem der Ameise und lösen in ihr Verhaltensänderungen dahingehend aus, dass sie sich temperaturabhängig vermehrt an Stellen aufhält, um vom Endwirt Wiederkäuer mit der Äsung aufgenommen zu werden, z. B. am oberen Ende von Gräsern. Hier löst der Parasit über die Neurone aus, dass sich die Ameise dort festbeißt. Zu diesen und anderen bemerkenswerten Manipulationsfähigkeiten von Parasiten gibt es auch Videos im Internet. Vom Dünndarm der Wiederkäuer gelangen die unreifen Larven in die Leber oder Bauchhöhle, wo sie die Entzündung auslösen. Ihre Migration durch die Leber hinterlässt zunächst mechanische Gewebsdefekte mit dunkelroten, blutgefüllten Bohrungen, bevor sie bis in die Gallengänge gelangen. So wie vom Einsender richtig erkannt, entstehen auch Leberabszesse. Mit der Zeit vernarben diese Stellen und färben sich beige-weiß-gelb-grau infolge der Bindegewebszubildung. Bei hohem Befall ist die Parasitose für den Wirt tödlich. Wenn die Gallengänge durch Egel verstopft werden, entsteht durch die Stauung eine zähe, braune Gallenflüssigkeit, Schleimhaut vermehrt sich, es entstehen Entzündungen, Härtungen, Weitung und Kalzifizierungen (Mineralisation), die die Kanäle im Anschnitt wie starre „Pfeifen“ aussehen lassen. Schäden durch den tatsächlich größeren, blattförmigen Großen Leberegel sind gravierender. Dieser benötigt jedoch nur bestimmte Schneckenarten als einzigen Zwischenwirt und damit Feuchtgebiete. Eine befallene Leber, wie hier, ist unschädlich zu beseitigen. Bei den weißen, runden Gebilden um das Gescheide, den Darm, handelt es sich wohl tatsächlich nur um Feisteinlagerungen.
Haben Sie eine Frage an unsere Experten? Schreiben Sie uns: Redaktion WILD UND HUND, Stichwort: „Experten“, Postfach 13 63, 56373 Nassau, oder per E-Mail an wuh@paulparey.de