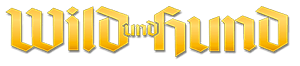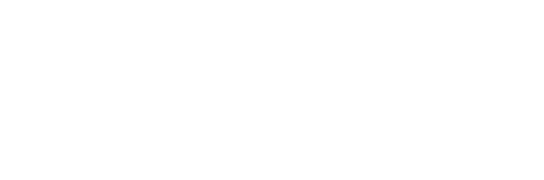Interview mit Laurens Hoedemaker
Interview mit Laurens Hoedemaker
Im September 2024 hat der Holländer Laurens Hoedemaker (53) in der Zentrale des Europäischen Jagdverbandes (FACE) in Brüssel das Ruder übernommen. WILD UND HUND traf den Tierarzt und Vorsitzenden der Königlich niederländischen Jagdvereinigung zum Interview in Dortmund.

Bild: Anoeska Vermeij
Hoedemaker: Wir leben in neuen Zeiten, auch in Brüssel hat sich einiges verändert. Nicht nur politisch. Auch FACE ist in den vergangenen 6 Jahren unter Torbjörn Larsson eine starke Lobbyorganisation geworden. Wir haben ein gutes Team um Dr. David Scallan, solide Finanzen und eine klare Strategie.

WuH: Wenn Sie von einer klaren Strategie sprechen - welche ist es denn?
Hoedemaker: Wir haben einen 5-Jahres-Plan von Zielen festgelegt, die wir erreichen wollen. Eines der Ziele war z. B. die Senkung des Schutzstatus des Wolfes, um ihn auf nationaler Ebene managen zu können. Aber lassen Sie mich noch kurz etwas zu den Niederlanden sagen: Auch dort haben sich die Zeiten geändert. Wir haben nicht nur einen neuen Landwirtschaftsminister. Er will das bestehende Jagdgesetz nicht nur evaluieren, sondern es auch ändern. Gemeinsam mit der Königlichen Jagdvereinigung möchte man zu einem Gesetz kommen, das dem dänischen Jagdgesetz ähnelt. Wir haben 42 jagdbare Arten in den Niederlanden. Alle 5 Jahre überprüfen wir den Populationsstatus und legen fest, ob sie bejagbar sind oder nicht.
WuH: Das wäre ja ein kompletter Paradigmenwechsel.
Hoedemaker: Ja, absolut. Es wäre die größte Jagdgesetzreform der vergangenen 30 Jahre. Wir haben nicht nur einen jagdfreundlicheren Politikwechsel in Holland, sondern eben auch in Brüssel. Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren für die Jagd in Europa viel erreichen können.
WuH: Es gab in den letzten Tagen von Torbjörn Larsson starke Kritik vom Ex-FACE-Präsidenten Michl Ebner am politischen Kurs der FACE. Er kritisierte, dass man bei der Verabschiedung des EU-Nature Restoration Laws mit den Umweltverbänden gemeinsame Sache gemacht hätte und Jagd als Position in dem Gesetz nicht festgeschrieben habe. Teilen Sie diese Kritik?
Hoedemaker: Ich schätze Michl Ebner als Ex-FACE-Präsident sehr. Ich habe mit ihm schon zusammengearbeitet. Aber die Herausforderungen haben sich verändert, und was vergangen ist, sollte auch dort bleiben. Ich schaue nach vorne, was wir noch liefern können.

WuH: Aber wie gefährlich ist es, dass die Jagd nicht im neuen Gesetz verankert ist?
Hoedemaker: Jagd ist ein wichtiger Bestandteil, um Lebensräume für Wildtiere zu erhalten, zu schaffen oder auch das Gleichgewicht in der Natur wieder herzustellen. Das wissen in Brüssel inzwischen auch die neuen Politiker. Daher habe ich keine Angst davor, dass die Jagd in dem neuen Gesetz unter Druck gerät. Kleine Anti-Jagd-Gruppierungen erwecken gern den Eindruck, dass große Teile der europäischen Bevölkerung die Jagd ablehnen. Das stimmt nur, solange ihnen keiner widerspricht. Wir tun das, und wir können mit knallharten Fakten belegen, dass die Mehrheit der Europäer Jagd befürwortet.
WuH: In Brüssel lässt sich Politik nur mit Allianzen machen. CIC-Präsident Philipp Harmer kritisierte, dass FACE bei der Entstehung des EU-Nature Restoration Laws grundlos die Allianz mit den Grundeigentümern aufgekündigt hätte. Wie stark ist die Allianz mit den Nutzerverbänden?
Hoedemaker: Ich weiß nicht, wieso Philipp Harmer diesen Eindruck hat. Nach wie vor arbeiten die European Landowner Organisation (ELO) und FACE eng zusammen, um eine starke Interparlamentarische Arbeitsgruppe hinzubekommen. Sie ist traditionell eine der 4 großen Arbeitsgruppen mit über 100 Mitgliedern, und ich hoffe, dass wir in enger Abstimmung mit ELO wieder viele Abgeordnete dazu bringen, in dieser mitzuarbeiten. Ich glaube, dass der CIC sich international kümmern und uns das Geschäft in Brüssel überlassen sollte.

WuH: Sie haben in den vergangenen Tagen ein Positionspapier herausgegeben, in dem FACE seine Vorstellungen einer künftigen Gemeinschaftlichen Agrarpolitik formuliert. Ist dieses Papier mit den Bauern und der ELO abgestimmt?
Hoedemaker: Die wichtigste Message dieses Papiers ist, dass Bauern den Schlüssel für Artenvielfalt im Feld in der Hand haben und diese Artenvielfalt auch herstellen können. Dafür müssen sie aber fair bezahlt werden. Darin sind wir uns mit den Bauern einig. Es muss Schluss mit unsinnigen Agrarsubven- tionen sein, die der Artenvielfalt schaden. Gerade das Niederwild hat nur eine Chance, wenn wir ihm in der intensiv genutzten Agrarlandschaft auch Raum lassen.
WuH: Ein großes Thema der vergangenen Jahre war ein Trophäenimport- verbot in die EU. Wir groß sehen Sie die Gefahr, dass dieses wieder auf die Tagesordnung kommt?
Hoedemaker: Der Ruf nach einen Trophäeneinfuhrverbot ist nichts anderes als eine moderne Form des Neokolonialismus. Europäische Staaten versuchen, mit einem Verbot der Trophäenjagd anderen, meist Entwicklungsländern, zu sagen, wie sie ihr Wildtiermanagement gestalten sollen. Ich glaube, dass dieser Kurs in Europa immer weniger Befürworter hat. Die Kommission arbeitet sehr faktenbasiert. Je nachdem wie in Umfragen gefragt wird, gibt es eine große Zustimmung zur Jagd. Wenn aber die Fragen in Zusammenhang mit der Trophäenjagd gebracht werden, gibt es viel mehr Ablehnung in der normalen Bevölkerung. Darauf müssen wir achten, wenn vor der Kommission mit Umfragewerten argumentiert wird. Das haben wir aber auf dem Zettel und werden uns mit ausgewogenen Umfragezahlen gegen Angriffe auf die Jagd wappnen, denn immerhin haben einige europäische Länder im Alleingang ein Importverbot verhängt.
WuH: Im vergangenen Jahr gab es ja eine große Kampagne „Sign for hunting“. Doch nur 5 % der 7 Mio. Jäger haben sie unterzeichnet. Ist die FACE europaweit wirklich kampagnenfähig?
Hoedemaker: Für unsere erste große Kampagne waren 360 000 sehr gut ...
WuH: Nach einem Jahr ...?
Hoedemaker: Es war eine der größten Umweltkampagnen in Brüssel, die es je gab. Für uns war wichtig zu lernen, wie wir und ob wir jeden einzelnen Jäger in Europa erreichen können. FACE ist eine Vereinigung nationaler Jagdverbände. Wir haben keinen direkten Zugriff auf deren Mitglieder. Als Lobby-Organisation wissen wir, wie wir über die nationalen Jagdverbände Einfluss auf Politiker nehmen können. Kampagnen zu entwickeln, bei denen wir 7 Mio. Jäger direkt mobilisieren, ist Neuland für uns. Wir müssen auch aufpassen, dass wir dabei unsere natioanalen Verbände nicht umgehen. Wir konnten aber durch diese Kampagne sehr stark sehen, welche der Verbände in der Lage waren, ihre Mitglieder zu mobilisieren. Es geht jetzt darum, einzelne nationale Jagdverbände zu unterstützen, ihren Jägern klarzu- machen, dass es auch wichtig ist, sich für europäische Belange stark zu machen.
WuH: Wie wollen Sie das erreichen?
Hoedemaker: Man muss sehen, dass die Verbandsstrukturen unserer Mitglieder sehr unterschiedlich sind. Um einen Zugriff auf deren Mitglieder zu haben, müssen einige über ihre Regionalverbände gehen. Andere sind nicht digitalisiert und müssen ihre Mitglieder anschreiben und bei Unterschriftenkampagnen handschriftlich ausgefüllte Listen austeilen und wieder einsammeln. Es gibt auch in einigen Ländern keine Kampagnenkultur.
Wir stehen vor sehr unterschiedlichen Herausforderungen, um kampagnenfähig zu werden. Wenn man das alles berücksichtigt, waren 360 000 Unterschriften ein riesiger Erfolg.
WuH: Es gibt Themen, die natürlich alle europäischen Jäger beschäftigen, wie z. B. das jetzt in Kraft tretende Bleiverbot. Ist da etwas versäumt worden, und lässt sich das Bleiverbot für Munition noch verhindern?
Hoedemaker: Nein, das wird kommen. Schauen Sie einmal auf die Umweltpolitik der vergangenen Jahre. Es wurde schon vor Dekaden Blei im Benzin verboten, wir haben es in Wasserleitungen verboten, weil wir wissen, dass es giftig ist. Wir können nicht sagen, dass wir als Jäger mit der Natur verbunden sind und diese bewahren wollen und bringen selbst giftige Stoffe aus. Es gibt inzwischen Alternativen bei Büchsen- und Flintenmunition, mit denen wir arbeiten können. Ich gebe aber zu, dass wir gerade bei der Kleinkalibermunition ein Thema haben, wo wir Blei nicht ersetzen können und natürlich mit der Kommission diskutieren müssen, ob angesichts des geringen Einflusses, den diese Munition draußen hat, ein Verbot mit all den weitreichende Konsequenzen gerechtfertigt ist. Wir werden dort längere Übergangsphasen brauchen. Genauso brauchen wir längere Übergangsphasen für den Gebrauch von Bleimunition auf Schießständen.
WuH: Von welchen Fristen reden wir da?
Hoedemaker: Die Europäische Chemikalien Agentur sagt, dass Blei aus Flinten in 5 Jahren Vergangenheit sein sollte. Bei Büchsenmunition haben wir ein Moratorium von 18 Monaten. Bei Randfeuerpatronen und Luftgewehrmunition sollte in 5 Jahren eine Lösung gefunden sein.
WuH: Also ist hier kaum mehr was zurückzudrehen?
Hoedemaker: Die Kommission ist, was das Bleiverbot angeht, schon 2 Jahre in Verzug. Das hat u. a. etwas mit der sicherheitspolitischen Lage in Europa zu tun, denn das Militär ist darauf angewiesen, nach wie vor mit Blei Munition zu produzieren.
WuH: Lassen Sie mich noch einmal auf den Wolf zurückkommen. Wie schnell, glauben Sie, wird der Wolf in der EU jagdbar werden?
Hoedemaker: Wir haben schon viele Schritte in die richtige Richtung gemacht. Die Berner Konvention hat beschlossen, den Schutzstatus zu senken. Es gibt einen Beschluss der Umwelt- minister. Es gibt jetzt einen Vorschlag der Kommission, den Wolf in den Anhang V der FFH-Richtlinie zu bringen. Jetzt ist es an den Ländern, einer Änderung der FFH-Richtlinie zuzustimmen, und danach sollten die Mitgliedstaaten zügig einen guten Erhaltungszustand nach Brüssel melden, damit sie entsprechende Regelungen für ein nationales Bestandsmanagement umsetzen können. Da sind noch einige politische Entscheidungen zu treffen.
WuH: Ist es nicht mühsam, für jede Wildart diesen langen Weg durch die Institutionen zu gehen? Soll das für den Bär und den Schakal ähnlich zäh laufen?
Hoedemaker: Ich finde es wichtig, dass wir diesen Weg jetzt einmal Schritt für Schritt gehen. Wenn erst ein Verfahren steht, glaube ich, dass es für andere Arten leichter wird. Wir müssen uns erst einmal über gewisse Prinzipien verständigen, wie wir managen wollen.
Die Fragen für WILD UND HUND stellte Heiko Hornung.
Autor: Heiko Hornung