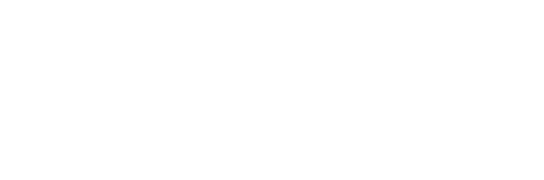In Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz brodeln die Debatten über die Rotwildgebiete, befeuert von den jüngsten Erkenntnissen zur Inzucht im Bestand. Inmitten dieser Debatte hat der Jurist und Jagdrechtskommentator Dr. Michael Pießkalla einen brisanten Fachbeitrag zur Frage veröffentlicht, ob die Rotwildgebiete überhaupt rechtskonform sind.
WuH: In Bayern sind 14 % der Landesfläche als Rotwildgebiete definiert, in Baden-Württemberg sind gar nur 4 %, der Rest ist laut Verordnung „rotwildfrei zu machen und zu halten“. Aktuell fordern mehrere Jagd- und Umweltverbände, die rotwildfreien Gebiete aufzulösen. War das der Anlass für Sie, die Sache juristisch zu beleuchten?
Dr. Pießkalla: Der Anlass war tiefergehendes Interesse. Eigentlich habe ich mich schon während der Jagdausbildung gefragt, wie es sein kann, dass man Wildtiere, die ja nach Bundesnaturschutzgesetz und internationalen Verpflichtungen ihre Lebensräume bevölkern sollen, auf einen Bruchteil der Landesfläche zurückdrängt und das als gegeben akzeptiert.
WuH: Welchen Rechtfertigungsgrund sehen Sie, an den rotwildfreien Gebieten festzuhalten?
Dr. Pießkalla: Die Idee der rotwildfreien Gebiete stammt aus den 1950erJahren. Das war die Phase kurz nach dem Krieg, in der man über Wiederaufbau und in Richtung Wirtschaftswunder dachte. Eine Phase also, in der man viel Holz brauchte und den Grundeigentümern Wildschäden ersparen wollte, indem man Rotwild auf einem Großteil der Landesfläche gar nicht mehr zuließ.
WuH: Was sind Ihre Kritikpunkte an der politischen Linie der rotwildfreien Gebiete heute?
Dr. Pießkalla: Aus meiner Sicht ist das, was damals den Ausschlag gegeben hat, nicht mehr zeitgemäß. Man muss andere Wege eines Ausgleichs mit den Interessen der Grundeigentümer finden. Dafür ist aber im Jagdrecht keine Abschottung von Rotwildgebieten vorgesehen, sondern primär die Abschussplanung.

Der Jurist und Jagdrechtskommentator Dr. Michael Pießkalla veröffentlichte seinen Beitrag in Ausg. 4/2023 der „Bayerischen Verwaltungsblätter“. (Bild: Vivienne Klimke)
WuH: Die Abschussplanpflicht für Schalenwild gemäß Bundes- wie auch Bayerischem Jagdgesetz gilt für Rotwild in den rotwildfreien Gebieten nicht. Wie beurteilen Sie das juristisch?
Dr. Pießkalla: Hier muss ich etwas ausholen. Seit der Föderalismusreform dürfen die Bundesländer in ihren Jagdgesetzen in weiterem Umfang als davor von den Regelungen des Bundesjagdgesetzes abweichen. Wenn Bayern sich also hier und heute entscheiden würde, die Regelungen, die im Bayerischen Jagdgesetz und seiner Ausführungsverordnung enthalten sind, nochmal zu verabschieden, wäre das theoretisch denkbar. Es würde allerdings eine Diskussion voraussetzen, deren Ausgang m. E. völlig offen ist. Ausgehend davon, dass Bayern Rechtsvorschriften anwendet, die weit vor der Föderalismusreform in Kraft getreten sind, muss sich die damals geschaffene Rechtslage auch an den damals geltenden Vorschriften messen lassen. Das bedeutet: § 21 Absatz 2 des Bundesjagdgesetzes, der vorsieht, dass Schalenwild außer Schwarzwild nur mit Abschussplan bejagt werden kann, gilt in Bayern bis heute.
WuH: Es gibt aus den vergangenen Jahrzehnten Studien, die die genetische Verarmung der isolierten Rotwildpopulationen in Bayern und Deutschland nachweisen. Finden Sie diese Aspekte im Gesetz ausreichend berücksichtigt?
Dr. Pießkalla: Nein. Ich sehe die Erkenntnisse zur Genetik heute nicht mehr berücksichtigt. Die Abschusspflicht wurde nämlich stetig verschärft. In der ersten Fassung des Jahres 1968 war der Abschuss von Hirschen der Klassen I und IIa untersagt, außerdem bestand noch eine Abschussplanpflicht auch im rotwildfreien Gebiet. Davon blieb 1983 nur noch die Abschussplanpflicht übrig, die 1988 ebenfalls gestrichen wurde. Der Ursprung hierfür lag in der immer lauter werdenden Diskussion über die Trophäenjagd – so, als sei die selektive Bejagung weniger ein Aspekt des Genaustausches als einer von starken Trophäen. Dabei spricht ein gutes Geweih auch für körperliche Kraft und Vitalität.

Die Karte zeigt die ausgewiesenen bayerischen Rotwildgebiete. Besonders das Vorkommen in den Isarauen (2) ist durch die aktuelle Rechtslage isoliert. (Bild: Wildes Bayern)
WuH: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Koblenz hat 2002 sogar entschieden, dass die Vernichtung eines Wildbestands geboten sein kann, auch oder gerade wenn ihm eine Degeneration droht. Wie beurteilen Sie das?
Dr. Pießkalla: Ich halte das in dieser Form für nicht vertretbar. Zwar sieht das Jagdrecht den Hegeabschuss vor, der darauf abzielt, auch außerhalb der Jagdzeit kranke Stücke aus einer Population zu entnehmen. Aber das OVG Koblenz differenziert nicht nach dem Grund für die genetische Verarmung. Und wenn es die Auffassung vertritt, dass der Mensch, der zunächst dafür sorgt, dass das Rotwild genetisch verarmt, zur Lösung des von ihm geschaffenen Problems dann den Totalabschuss vornimmt, macht es buchstäblich den Bock zum Gärtner. Ich lese in dieser Entscheidung sehr wenig über Naturschutz und gar nichts von der Berner Konvention.
WuH: Welche Aspekte der Rotwildgebiete berühren denn das Naturschutzrecht?
Dr. Pießkalla: Diverse! Wir haben im Bundesnaturschutzgesetz zum Beispiel in § 1 Absatz 1, 1. Halbsatz die grundsätzliche Vorgabe, dass Natur und Landschaft einen eigenen Wert haben. Da ist zudem ausdrücklich von der Erhaltung der biologischen Vielfalt die Rede. Die Länder können hiervon nicht abweichen. § 1 Abs. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes schreibt zudem vor, lebensfähige Populationen wild lebender Tiere einschließlich ihrer Lebensstätten zu erhalten und Austausch zwischen ihren Populationen sowie Wanderungen und Wiederbesiedlungen zu ermöglichen. Hier muss ein Minimum an genetisch differenzierten Populationen erhalten werden! Auf Verfassungsebene haben wir zudem Artikel 20a des Grundgesetzes, der die biologische Vielfalt, den Natur-, Tier- und Artenschutz sogar als Staatsziele definiert. Wir sprechen also nicht von Banalitäten, sondern von sehr grundsätzlichen Dingen.
WuH: Deutschland hat auch die Berner Konvention ratifiziert, und diese verbietet Maßnahmen, die zum Verschwinden einer Art führen können. Welche Kraft messen Sie diesen Regelungen bei?
Dr. Pießkalla: Die Berner Konvention kann in ihrer Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden. Vieles, was im Völkerrecht vorgesehen ist, findet sich im europäischen Recht auf der sogenannten sekundärrechtlichen Schiene in der FFH- und der Vogelschutzrichtlinie wieder. Das zeigt, dass die Europäische Union es mit der Berner Konvention ausgesprochen ernst meint. Sie ist schließlich Vertragspartei. Wichtig ist, dass die von der EU geschlossenen völkerrechtlichen Verträge unmittelbar bindend für die EU und die Mitgliedstaaten sind. Sie stehen also auf der Primärrechtsebene, ebenso wie die Grundrechts-Charta. Das verpflichtet auch staatliche Untergliederungen, also die Länder. Interessant ist übrigens, dass die Berner Konvention bei allen Cerviden einen besonderen Schutz implementiert, anders als die FFH-Richtlinie, die die Hirschartigen – anders als zum Beispiel das Gamswild – nicht für besonders schützenswert hält. Die Konvention schreibt zudem vor, dass wild lebende Tiere und Pflanzen sowie ihre natürlichen Lebensräume zu erhalten sind. Und natürliche Lebensräume sind beim Hirsch deutlich mehr als das, was der Mensch ihnen zugesteht.
WuH: Das Naturschutzrecht steht nicht über dem Jagdrecht. Welche Rolle spielt es also, wenn es um die rotwildfreien Gebiete geht?
Dr. Pießkalla: Weil etwas jagdrechtlich vorgesehen ist, kann es trotzdem mit höherrangigem Naturschutzrecht – und das ist Kritik am Normgeber – nicht im Einklang stehen. Naturschutzrechtlich sind die rotwildfreien Gebiete ein ganz erheblicher Eingriff . Ich halte ihn im Ergebnis für nicht mehr gerechtfertigt. Wenn wir also über die bayerische Rechtslage sprechen, würde das heißen, wir überprüfen § 19 Absatz 2 der Ausführungsverordnung zum Bayerischen Jagdgesetz, der zur Ausrottung von Rotwild außerhalb der Rotwildgebiete zwingt – ohne Abschussplan.

Ein erlegter Hirsch mit verkürztem Unterkiefer: Klassisches Symptomfortgeschrittener Inzuchtdepression. (Bild: Dr. Rainer Hospes)
WuH: Wie wäre diese Überprüfung durchzuführen, und durch wen?
Dr. Pießkalla: Die Ausführungsverordnung zum Bayerischen Jagdgesetz wäre meines Erachtens im Rahmen einer Normenkontrolle überprüfbar. Das könnten in beschränktem Maße die Jagdausübungsberechtigten tun, deren Reviere im rotwildfreien Gebiet liegen. Sie könnten gegen die Abschussverpflichtung klagen. Weitergehende Befugnisse haben die anerkannten Umweltverbände, wie der Bayerische Jagdverband oder der Verein Wildes Bayern. Das Umweltrechtsbehelfsgesetz ist hier nach aktueller Rechtsprechung anwendbar, auch wenn es Normenkontrollen in diesem Bereich nicht ausdrücklich vorsieht. Aber seine Vorgabe ist, dass Umweltverbände Umwelteingriffe einer rechtlichen Überprüfung unterziehen können sollen.
WuH: Sehen Sie persönlich eine Lösung darin, die rotwildfreien Gebiete aufzulösen, und wie würde dann den berechtigten Anliegen der Land- und Forstwirtschaft Genüge getan?
Dr. Pießkalla: Die derzeitige Regelung gibt den Grundeigentümern ein Maximum an Schutz, stellt aber die schützenswerten Interessen der Wildtiere zu sehr in den Hintergrund. Als Ausgleich würde ich das nicht bezeichnen. Nach § 21 des Bundesjagdgesetzes findet der Ausgleich vielmehr über die revierbezogene Abschussplanung statt.
WuH: Geben Sie dem Anliegen, Rotwild wieder auf ganzer Landesfläche regulär zu hegen und mit Abschussplan zu bejagen, eine Chance?
Dr. Pießkalla: Ich finde jedenfalls, dass die Argumente gegen die rotwildfreien Gebiete und für eine Neukonzeption besser sind als jene, den Status quo zu erhalten. Details sollten im Rahmen einer breiten Debatte diskutiert werden.
Das Interview für WILD UND HUND führte Vivienne Klimke.