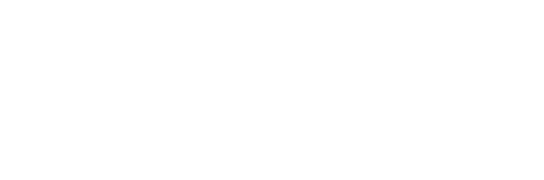Naturschutz und Waidwerk
„Ein echter Streitpunkt"
Jörg-Andreas Krüger ist Präsident des Naturschutzbundes Deutschland (NABU). Damit steht ein aktiver Jäger an der Spitze des größten deutschen Umweltschutzverbandes. Im Gespräch mit WILD UND HUND stand er Rede und Antwort zu Wolf, Wald-Wild-Konflikt und dem häufig belasteten Verhältnis zur Jägerschaft.

Bild: NABU/Frank Müller Fotografie
Krüger: Es hat mich einfach interessiert. Ich bin ganz stark geprägt von dem großelterlichen Bauernhof aufgewachsen, wo regelmäßig die Stockenten, die man beim Nachbarjäger holte, erst an der Hippe noch 1, 2 Tage hingen, und dann wurde gerupft. Dann begegnete mir im Naturschutz immer wieder die Sache mit dem Grünen Abitur. Da habe ich gedacht, na ja, das kann ich auch, weil ich es ja quasi studiert habe. Also habe ich den Jagdschein gemacht bei der Kreisjägerschaft Hannover, ganz normal diesen längeren Kursus. Da habe ich gemerkt, ok, natürlich war ich bei vielen Arten wie Federwild, auch Wildökologie und Landschaftsökologie sowie Landwirtschaft gut aufgestellt, das war irgendwie alles nix Neues für mich. Aber die Waffenhandhabung, das Waffenrecht, die Fragen von Brauchtum, von Jagdhunden und alle diese Dinge, da habe ich dann schon noch mal was gelernt.
WuH: Wie und wie viel jagen Sie aktuell?
Krüger: Ich habe aktuell 2 Begehungsscheine für Flächen, die im Waldumbau sind. Dort versuche ich schon, regelmäßig anzusitzen. Am Ende komme ich aber nur auf 10, 12 Ansitze pro Jahr. Mehr ist zeitlich einfach nicht drin. Es ist ausschließlich Schalenwildjagd. Da geht es den Flächeneigentümern sehr darum, vor allem Rotwild und Damwild zu reduzieren.
WuH: Sie sind 2019 vom WWF zum NABU zurückgekehrt, kennen also 2 Naturschutzorganisationen aus der Binnensicht. Wo sind Gemeinsamkeiten und Unterschiede und wie positionieren Sie den NABU gesellschaftspolitisch im Kanon vergleichbarer Organisationen von BUND bis Greenpeace?
Krüger: Zwischen NABU und WWF gibt es im Wesentlichen 3 Unterschiede: Im NABU engagieren sich rund 70 000 Ehrenamtliche, die in Ortsgruppen, Landesverbänden und Fachausschüssen organisiert sind. Der WWF arbeitet weitestgehend ohne Ehrenamtliche. Zudem ist der WWF als Stiftung strukturell anders aufgestellt als wir. Im NABU erarbeiten Mitglieder in demokratischen Prozessen gemeinsame Positionen. Diese Positionen lenken den Verband. Beim WWF liegt diese Entscheidung beim Vorstand oder dem Stiftungsrat. Und natürlich ist der WWF deutlich stärker im Aus- als im Inland aktiv, während der NABU überwiegend in Deutschland arbeitet. Einen gesellschaftspolitischen Unterschied zwischen den Organisationen sehe ich nicht, aber natürlich kommen alle aus unterschiedlichen Gründungszeiten. Der NABU wurde bereits 1899 in der ersten Naturschutzbewegung gegründet. Der Schutz der Natur steht für uns seit dieser Zeit gemeinsam mit dem Erleben von Natur, der Freude an ihr, im Mittelpunkt.

WuH: Nach Ihrer Wahl zum Präsidenten wurde Ihr Jägersein breiteren Kreisen bekannt. Die Folge waren erhebliche Diskussionen unter NABU-Mitgliedern bis hin zu Rücktrittsforderungen und Ankündigungen, ansonsten selbst auszutreten. Wie haben Sie das empfunden?
Krüger: Das hat sich zum Glück ziemlich beruhigt. Ich weiß natürlich, dass es im NABU immer eine ganz intensive Diskussion mit Jagd und über Jagd gibt. Das hat oft damit zu tun, dass Jagd und Naturschutz oder NABU und Jagd von unterschiedlichen Startpunkten kommen, obwohl wir in vielen Dingen ähnliche Ziele haben. Ich habe das ähnlich auch immer wieder ziemlich intensiv vertreten. Denn ich sage, zeitgemäßer Naturschutz braucht Lobbyarbeit, der braucht Kenntnis, der braucht einen Spaten oder Bagger, der braucht aber in Einzelfällen auch eine Waffe. Da muss man sich ehrlich machen. Deswegen vertrete ich nach wie vor offensiv, dass Wildtiermanagement und auch Jagd zum Naturschutz gehören.
WuH: Sind die Anfeindungen, die Sie erlebt haben, nicht auch Ausdruck einer generellen Konfrontation von Jagd und Naturschutz oder eines generell gestörten Verhältnisses vieler Menschen im Naturschutz zur Jagd?
Krüger: Das sehe ich nicht so. Ich denke, das kennt auch jeder Jäger aus seinem persönlichen Umfeld, dass es Menschen gibt, die sich schwer mit dem Gedanken tun, da tötet jemand Tiere. Das kann man aber auch in der Argumentation aushalten. Ich würde es auch nicht als Anfeindungen betrachten. Es sind damals Einzelstimmen gewesen, die da sehr klar waren und gesagt haben, es passt für sie nicht mit dem Bild des NABU zusammen. Aber wir haben als NABU eine klare Position: Jagd ist eine anerkannte Landnutzung. Sie muss sich wie alle anderen Landnutzungen ökologisch nachhaltig ausrichten. Sie muss ethischen Gesichtspunkten genügen. Aber sie gehört eben dazu.
WuH: Hat die Konfrontation auf der Verbändeebene auch etwas mit Abgrenzung aus Profilierungsgründen und persönlichen Eitelkeiten zu tun?
Krüger: Ich sehe die Konfrontation nicht so stark, wie sie vielleicht von außen wahrgenommen wird. Klar, wir haben unsere Reibungspunkte. Wir haben Themen, wie die Jagd auf wandernde Arten, Jagd auf gefährdete Arten oder die Frage, wie man Jagd in Schutzgebieten organisiert. Da kann man immer wieder Punkte finden, an denen mal die eine oder die andere Seite überzieht oder überzogen hat und etwas falsch gemacht hat. Aber wenn man es sich in der Breite anguckt, dann sind wir aus der Konfrontation der 1970er- und 1980er-Jahre ein deutliches Stück weg. Das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Die müssen wir jetzt für das, was vor uns liegt, noch deutlich stärker vorantreiben, weil die Landschaft und der ländliche Raum aus unterschiedlichen Gründen und Triebfedern in einem derartigen Wandel sind. Wenn wir es nicht schaffen, da gemeinsam an Zielen zu arbeiten, dann wird das mit der Zielerreichung wahnsinnig schwer.
WuH: Wie stellen Sie sich das vor?
Krüger: Wir können uns auf der Bundesebene noch jahrelang streiten. Auf der Ebene der Bundesländer klappt die Einigung nur schwer. Aber vor Ort kann es gelingen, wenn wir gegenseitig die unterschiedliche Sichtweise anerkennen und zugleich gemeinsam nach gangbaren Lösungswegen suchen. Als NABU wollen wir Konzepte regionalisieren, und gemeinsam müssen wir lernen, den Ballast der Vergangenheit mit Gelassenheit zu ertragen.
WuH: Müssen Jägerschaft und Naturschützer nicht auch viel stärker das Gemeinsame betonen angesichts einer Forstpartie, die den Wald immer vehementer vorrangig als ökonomisch auszubeutende Ressource versteht?
Krüger: Wir haben mit der Frage „Wie viel Wild verträgt der Wald?“ einen echten Streitpunkt. Für uns als NABU ist dabei ganz klar, dass Wildtiere in den Wald gehören. Nicht jede Lebensäußerung des Wildes ist ein Schaden und muss zur Regulation führen. Auf der anderen Seite sind die Wildbestände in den beiden Revieren, in denen ich tätig bin, wirklich sehr, sehr hoch. Dort stehen lauter Bonsai-Buchen, und es kommt wirklich gar nichts an Naturverjüngung hoch. Das ist nicht das, was wir brauchen, um Wälder in die Zukunft zu bringen. Ich sehe deshalb vor uns eine Phase des erhöhten Jagddrucks auf Schalenwild, damit wir diese Wälder wieder hochkriegen. Wenn die Pflanzen aus dem Äserbereich herausgewachsen sind, wird der Jagddruck automatisch wieder zurückgehen.
WuH: Aber wir haben es mit Forderungen nach großflächigen Schonzeitaufhebungen und manchmal sogar mit einem Infragestellen des Muttertierschutzes zu tun.
Krüger: Da haben wir als Verband ein ganz klares Bild und sprechen uns für die meisten Schalenwildarten für eine Jagdzeit von September bis Ende Dezember aus, sodass wir sagen, möglichst viel Gemeinschaftsansitze, vielleicht auch möglichst viel Drückjagden, um den Erfolg zu erzielen. Einzelansitze zu machen, wenn man wirklich Wildreduktion erzielen will, ist ein langwieriger und dorniger Weg, der auch nicht schnell genug erfolgreich ist.
WuH: Sie selbst haben zu Beginn Ihrer Amtszeit eine vorbehaltlose Dialogbereitschaft betont.
Krüger: Ich persönlich habe viel Dialog mit Jägerinnen und Jägern, weil ich sie treffe. Wir haben auf der Ebene der Bundesverbände zwischen Deutschem Jagdverband und NABU immer wieder den Dialog. Wir haben ja durchaus Themen, die wir gemeinsam politisch voranbringen wollen, gerade Biotopverbundsysteme und Querungsbauwerke, also Fragen der wildökologischen Raumplanung. Daran arbeiten wir sehr stark gemeinsam. Ab und zu schaffe ich es auch, auf Veranstaltungen wie die Jahreshauptversammlung der Kreisjägerschaft Warendorf zu gehen und den Dialog wirklich in der Breite zu suchen. Das ist aber etwas, dass auch viele andere Ebenen des NABU, also die Landes- und Kreisverbände und die Ökologischen Stationen, immer wieder machen. Aber: Mehr geht immer.
WuH: Vor dem Hintergrund des geplanten Waldumbaus drehen sich gegenwärtig fast alle Diskussionen um das wiederkäuende Schalenwild. Geraten auch beim NABU die klassischen Niederwildarten vom Fasan bis zum Hasen aus dem Blick?
Krüger: Als wir unsere jagdpolitische Position aufgebaut haben, haben wir uns intensiv gefragt, was Arten sind, die heute jagdlich gut nutzbar sind. Wir gucken dabei wirklich auf eine Nutzung, also Fell, Federn oder Fleisch. Da sind bei uns auf der Liste der regulär jagdbaren Arten der Fuchs, die Stockente, der Fasan, der Feldhase, wenn er ungefährdet ist, und das Wildkaninchen. Wir haben für die 3 in Deutschland brütenden Gänsearten gesagt, da müssen länderspezifische Regelungen gemacht werden. Wir sind ansonsten skeptisch, wenn es darum geht, im Rahmen des Wildtier- und Prädatorenmanagements unkontrolliert und unkoordiniert vorzugehen. Wir gehen davon aus, dass es erforderlich sein kann, für den Schutz eines bestimmten Sumpfschildkröten-, Bodenbrüter- oder Entenvorkommens z. B. Waschbären zu regulieren. Das wird aber sehr konzentriert und fokussiert passieren müssen, weil man das nicht nebenbei und mit zufällig auf der Drückjagd angefallenen Waschbären erreichen kann. Das ist für uns Wildtiermanagement und nicht Jagd, weil nicht die Nutzung des Tieres und dessen Fells im Vordergrund stehen, sondern das Managementergebnis für den Natur- und Artenschutz.
WuH: Es finden sich aber durchaus Papiere des NABU, die den Fuchs nicht auf der Liste der jagdbaren Arten sehen, obwohl Ihr Verband in den vom ihm betreuten Gebieten mit insgesamt 24 000 ha und in seinen 33 Eigenjagden durchaus intensiv dem Fuchs nachstellt.
Krüger: Dabei handelt es sich wahrscheinlich um Papiere aus dem NABU-Landesverband in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß, dass es Landesverbände gibt, in denen anlässlich von Jagdgesetznovellen Diskussionen darüber geführt worden sind. Das ist auf dieser Ebene auch in Positionspapieren aufgenommen worden. Es entspricht aber nicht der Linie des Bundesverbandes. Für mich ist das Positionspapier maßgeblich, das von der Bundesvertreterversammlung beschlossen wurde. In diesem Papier ist der Fuchs auf der Liste der ganz normal bejagbaren Arten.

WuH: Dahinter steht doch die Frage, was etwa den Großen Brachvogel schützenswerter macht als Fasan und Rebhuhn.
Krüger: Für das Rebhuhn könnte ich ebenso sagen, dass man Prädatorenmanagement macht. Womit wir und auch viele unserer Mitglieder ein Thema haben, ist die Frage „Warum töten wir?“ Zur Nutzung von Fleisch und Fell ungefährdeter Arten sagen wir ja, die ist anerkannt und gewollt. Für alle anderen Bereiche braucht das Töten einen guten Grund, der das ethisch vertretbar macht. Das ist ein anderer Blickwinkel, der den Unterschied macht. Die Jägerschaft startet mehr von einem Nutzungsgedanken aus. Die Naturschützer stellen mehr den Schutzgedanken ins Zentrum, mit so wenig Eingriffen wie möglich in Ökosysteme und Populationen. Das ist die Reibung, die wir haben. Jedes Prädatorenmanagement muss einfach gut gemacht sein. Es muss ein spezifischer Rahmen da sein, und es muss ein Monitoring geben, ob der Erfolg auch gegeben ist. Denn leider muss man feststellen, dass sehr viele Füchse und Rabenkrähen geschossen bzw. erlegt werden, ohne dass sich auch an den Populationen von Fasan und Rebhuhn wirklich etwas tut. Da setzen wir an, indem wir sagen, entscheidend für eine Art ist im Wesentlichen der Lebensraum, da müssen wir gucken, was sich in einer intensiv genutzten Kulturlandschaft überhaupt verbessern lässt. Dann kommt Prädatorenmanagement noch mit dazu. Aber entscheidend ist der Lebensraum. Daher unsere große Zurückhaltung.
WuH: Wirft das nicht die generelle Frage nach dem Verständnis von Jagd auf?
Krüger: Das stimmt. Wir plädieren massiv dafür, die Liste der dem Jagdrecht unterliegenden Arten sehr kritisch zu revidieren und zu verkürzen. Warum etwa schießen wir Möwen entlang der Küste? Wir wollen nicht, dass Tiere einfach so getötet werden, weil man sie schon immer getötet hat.
WuH: Mit dem Wildtiermanagementsystem wird der Jagd eine dienende Funktion zugeschrieben, sei es zum Zweck des Waldumbaus, zur Seuchenprävention oder zum Schutz anderer Arten. Muss für diese Dienstleistung nicht eigentlich bezahlt werden?
Krüger: Das ist ein interessanter Aspekt, über den ich noch nicht genauer nachgedacht habe. Spontan würde ich sagen, das ist genau die Naturschutzkomponente der Jagd. Deshalb sind die Jägerschaften anerkannte Naturschutzverbände. Und ich weiß, dass es da auch ungemein viel Herzblut für Natur- und Artenschutzmaßnahmen gibt.
WuH: Stichwort Wolf. Wann ist der Günstige Erhaltungszustand gegeben?
Krüger: Das ist für mich eine sehr schwere Frage. Denn die Kriterien für den Günstigen Erhaltungszustand festzulegen, ist Aufgabe der Fachbehörden. Für mich ist dabei die Zahl der adulten Tiere, die im reproduktionsfähigen Alter sind, zu berücksichtigen, und es geht darum, ob die geeigneten Lebensräume einigermaßen flächig verteilt besiedelt sind, ob Austausch zwischen den Populationen besteht und es Wanderungsbewegungen zu den Nachbarpopulationen gibt. Wir warten alle gespannt darauf, dass das Bundesamt für Naturschutz seine Referenzwerte veröffentlicht, wo dann gesagt wird, wann genau es soweit ist. Wir sehen momentan, dass der Wolf sehr langsam in den Südwesten und Süden der Bundesrepublik einwandert. Es gibt außer den Stadtstaaten, Baden-Württemberg, Schleswig-Holstein und dem Saarland kein Bundesland mehr ohne reproduzierendes Rudel. Wir sehen aber auch, dass sich die Zuwachsrate der Wolfspopulation und die Zuwachsrate der besiedelten Reviere gerade deutlich verlangsamt. Wir hatten schon Jahre mit deutlich über 20 %. In den vergangenen Jahren sind wir so bei 10 % gewesen, wohl auch, weil der Zug in die Mittelgebirge langsamer und schwieriger ist.
WuH: Warum interpretieren andere Staaten, etwa Schweden, das Thema ganz anders als Deutschland?
Krüger: Schweden interpretiert nicht, sondern negiert europarechtliche Rahmenvorschriften. Das kann natürlich nicht der richtige Weg sein.
WuH: Wie soll der Wolf letztlich gemanagt werden, durch Aufnahme ins Jagdrecht, mit wolfsfreien Zonen?
Krüger: Die Diskussion um die Aufnahme ins Jagdrecht sehe ich sehr skeptisch. Die Frage ist, was wir damit erreichen wollen. Momentan haben wir vor allem dann die Diskussion, wenn es darum geht, die Zahl der Weidetierverluste zu reduzieren. Es gibt dabei oft die Forderung nach einer pauschalen Abschussquote. Da wissen wir aber, dass sie dem Herdenschutz nicht zwingend dient. Wir haben entsprechende Beispiele, etwa aus Frankreich, wo pro Wolf statistisch deutlich mehr Weidetiere gerissen werden, als es glücklicherweise bei uns der Fall ist. Wir wissen außerdem, dass man die Weidetierverluste sogar noch steigern kann, wenn man im falschen Moment eine stabile Rudelstruktur zerschießt. Momentan besteht die Situation, dass Konflikte mit Weidetieren vor allem dort entstehen, wo der Wolf neu aufkommt. Immer wieder lernt sozusagen eine Region neu, mit dem Wolf zu wirtschaften und zu leben. Wenn ein Erhaltungszustand erreicht ist, der ein konfliktfreies Zusammenleben von Mensch und Wolf ermöglicht, in dem wir unsere Weidetiere im nötigen Maß schützen, dann sehe ich für eine pauschale Bejagung nach wie vor keinen Grund. Wir haben inzwischen viel Erfahrung in den Bundesländern mit dem Aufbau von Förderrichtlinien für den Weidetierschutz, und wir sind auch alle miteinander einig, dass die Weidetierhalter nicht nur das Material, sondern auch den Aufwand bezahlt bekommen müssen. Denn der ist erheblich. Das Ganze muss schnell und zügig gehen. Genauso muss ein Wolf, der die Schutzvorrichtungen überwunden hat, entsprechend der geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen schnell entnommen werden.

WuH: Kann ein Ziel des Wolfsmanagements auch die Reduktion des Prädationsdrucks auf Schalenwildbestände sein?
Krüger: Das könnte ein Ziel sein. Gegenwärtig sehe ich aber keinen solchen Druck auf Schalenwildbestände. Da sind wir in einer sehr fernen Zukunft. Ein Mindestmaß an Prädation gehört zu jedem Ökosystem dazu. Das muss jeder ertragen. Wölfe haben außerdem nicht die großen Auswirkungen auf Schalenwildbestände.
WuH: Ist denn die Ausweisung wolfsfreier Zonen für den NABU denkbar?
Krüger: Beim Wolf kann ich mir die Aufteilung in Bewirtschaftungsgebiete und wolfsfreie Zonen nicht vorstellen. Rechtlich ist der Rahmen dafür nicht gesetzt, und fachlich gibt es keinen Grund. Wenn z. B. entlang der Deiche der Herdenschutz aufgebaut ist, kann ein Einzeltier, das diesen Herdenschutz zweimal überwunden hat, entnommen werden. Da muss man nicht pauschal sagen, z. B. in ganz Nordwestniedersachsen soll der Wolf nicht mehr leben können. Wenn Wölfe dort einen Lebensraum finden, sich von der bodenständigen Wildtierfauna ernähren, konfliktfrei dort leben, ist das keine Situation zu sagen, hier muss es wolfsfrei sein.
WuH: Aber gibt es nicht Bereiche, wie die Almen und Alpen, die sich nicht wirklich schützen lassen?
Krüger: Die sich schwerer schützen lassen. Die Frage ist immer, mit wie viel Veränderungsbereitschaft wir an die Sache herangehen. Wir wissen aus der Schweiz, dass es durchaus auch Möglichkeiten gegeben hat, die Herden zu vergrößern oder zusammenzulegen und dadurch eine positive Reaktion zu erzielen. Dann gibt es die Frage, ob man Nachtgatterung oder andere Lösungen hinkriegt. Diese Diskussion müssen wir schon führen, bevor wir einfach sagen, jeder Wolf, der in den Alpen ist, ist ein Wolf zu viel.
WuH: Aber führt die Vorstellung des NABU zum Umgang mit dem Wolf nicht zwangsläufig zur vollständigen Auslöschung des Muffelwildvorkommens in Deutschland?
Krüger: Ich weiß, dass viele das nicht hören möchten. Aber wenn eine nicht heimische Wildart sich nicht an die Rückkehr einer heimischen Art anpassen kann, dann ist das so.
Die Fragen für WILD UND HUND stellte Christoph Boll.
Autor: Christoph Boll